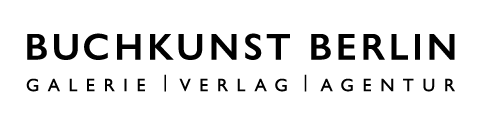Die Eröffnungsrede von Herrn Prof. Dr. Peter Steinbach zur Ausstellung NEUE ZEIT? 75 Jahre Kriegsende in der Galerie im Willy-Brandt-Haus hat uns sehr inspiriert und daher möchten wir es hier für alle, die aufgrund der aktuellen Lage bei der Vernissage nicht anwesend sein konnten, hier ausführlich wiedergeben.
Der Krieg war niemals der Vater aller Dinge. Er war immer der große Zerstörer. Lange galt er als naturgegeben. Wie kann der Zerstörer des Lebens, des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Zukunft gleichsam akzeptabel sein, nur weil man sich die Unausweichlichkeit des Krieges einredete – und damit der Vernichtung, die mit dem totalen Krieg eben todsicher wurde?
Gewiss: Krieg gab es immer. Er wurde gerechtfertigt als Kampf um Macht, als Drängen nach Vormacht, als Station auf dem Weg zur Durchsetzung nationaler Interessen, der Weltherrschaft. Stets war am Ende unbestreitbar, dass zumindest einer der Kämpfenden stets nahezu alles verlor. Und immer die Zivilbevölkerung zum Opfer wurde, gleich, ob besiegt oder auf der Siegerseite.

Vor allem die Kriege des 19. und des 20. Jahrhundert wurden immer unbedingter geführt, ohne Rücksicht auf die Kämpfenden und schließlich, an der sogenannten „Heimatfront“, im Hinterland der Front, ohne Achtung vor den Nichtkämpfenden. Verbrannte Erde war bald überall, gleichsam als Schicksal? Nur Erde? Nein Häuser, Dörfer, Menschen. Immer wenn es um Krieg geht, verharmlosen und verniedlichen wir. Schon als Kind verstand ich nicht, weshalb man von Gefallenen sprach, wenn es um Tote ging.
Nein, kriegerische Zerstörungen waren kein überwältigendes Ereignis. Verbrannte Erde wurde von Menschen gemacht und richtete sich gegen Menschen, gegen Wehrlose, nicht dem Schicksal, sondern anderen Menschen ausgelieferte! Denn Kriege ereigneten sich nicht, sie wurden von Menschen entfesselt, von Menschen geführt, von Menschen gemacht, sind Menschenwerk und deshalb – Einsicht vorausgesetzt – beeinflussbar. Und diese Aussage gilt im Präsens wie die folgenden!
Menschen litten, Machthaber rechtfertigten die Opfer, indem sie als Preis des Leidens und des Kämpfens eine Neue Zeit versprachen. Nehmen wir vielleicht sogar die Lügen der Machthaber auf, wenn wir von „Neuer Zeit“ sprechen?
Wir wissen, dass für die Besiegten niemals eine verheißungsvolle „Neue Zeit“ mit der Niederlage begann, sondern neue Not. Wir wissen auch, dass die Sieger sich niemals an ihre Versprechen hielten. Deshalb das Fragezeichen hinter „Neue Zeit?“. Dieses kommunikativ vielleicht schönste Satzzeichen hat noch eine weitere Funktion. Denn Fragen öffnen den Blick, stoßen Gedanken an, ermutigen zur selbstkritischen Reflexion.
Der Historiker liebt eigentlich das Ausrufungszeichen, er fühlt sich durch das Fragezeichen irritiert. Wir setzen es noch aus einem anderen Grund: Unser Fragezeichen soll sich nicht nur auf vergangene Ereignisse beziehen. Es wendet sich an uns, fordert uns hier und heute auf, uns selbst aufzuklären. Selbstaufklärung der Gesellschaft, das war das Motiv von Fritz Bauer.
Fotografien kommen dem entgegen, denn sie halten das Vergangene zwar fest, aber vergegenwärtigen es. Bilder beziehen sich auf Zurückliegendes, aber sie holen zugleich Vergangenheit in die Gegenwart, spiegeln Gegenwärtigkeit. Denn immer sehen wir diese Bilder hier und heute, mit jetzigen Augen, die sich zugleich mit dem Blick verändern können und müssen.
Denn Bilder laden zum Vergleich, zur komparatistischen Assoziation ein. Vergleiche setzen die individuelle Fähigkeit und die nicht selten schmerzende Bereitschaft zum sozialen und zeitlichen Transfer voraus.
Wenn wir wahrnehmen, dass in Warschau die Toten im September 1939 unter Gehsteigen bestattet wurden – wer dächte da nicht an Srebrenica? In der Ukraine wurden Menschen in Massengräbern flüchtig verscharrt, wie Keller auf schrecklich sachliche Weise festgehalten hat. Aber: Wer dächte da nicht an die Tragödien in Zentralafrika? Berlin 1945 – eine Trümmerwüste mit herumirrenden Menschen. Und die Kriegswüste Berlin 1945? Wer dächte da nicht an Aleppo, an die Zerstörungen der alten syrischen Städte?
Situationen, Zerstörungen, Sterbensängste, Überlebensnöte sind vergleichbar, immer vergleichbar, und weil sie vergleichbar sind, sind und bleiben sie universell, waren sie nicht nur, sondern sind sie. Und ich bin sicher: werden sie bleiben.
Es geht bei unseren Fotografien also nicht um Ästhetik, so großartig die Fotografen waren, sondern es geht uns in einer dem Politischen verpflichteten Galerie um uns als Betrachter, mit denen als Betrachter in der Selbstkonfrontation mit den Fotografien etwas geschieht. Denn es geht um das Entscheidende, um Leben und Sterben, um Erwartungen der Menschen und ihren Tod.
Wir verdanken diese Fotos Fotografen, die sich trotz unmenschlich anmutender – anmutend sage ich! – jahrelang sich erstreckender Ereignisse ihre zivilisierende Menschlichkeit nicht nehmen ließen, die nicht Zuschauer oder Mitläufer sind, die die Zukunft nicht kannten, den sechsjährigen Rassen- und Weltanschauungskrieg, den konservative Historiker inzwischen zum „europäischen Bürgerkrieg“ entschärfen. Sondern wir verdanken diesen Fotografen unseren Blick für die gequälte Existenz von Menschen, um ihre Sorgen, um ihre Recht auf Leben, ihre Furcht und ihre Hoffnung bewahrt haben.
Alle drei – der unbekannte deutsche Fotograf, Dieter Keller und Valery Faminsky – haben die Kraft hinzuschauen, wo andere wegschauten, Zeitgenossen, die später behaupten konnten, nichts gesehen zu haben. Keller straft sie Lügen. Es waren Fotografen, die der Propaganda der Ideologen vom Weltbürgerkrieg widerstanden hatten, den ihre Unmenschlichkeit durch rassenideologischen oder klassenideologische Fiktionen rechtfertigten, die nicht Mitmenschen sahen, von denen jeder „Rechte hatte“, wie Hannah Arendt später schrieb, sondern in ihnen, in Kindern, Frauen, Greisen nur bedrohliche und verwerfliche Gegenmenschen erkennen sollten.
Es waren keine Sensationen, die diese Fotografen suchten, keine kommerziell verwertbaren Fotos, auch keine Erinnerungsbilder, die sie daheim zeigen konnten, sondern diese Bilder sind Zeugnisse fotografischer Subversion, der Unbestechlichkeit des Auges, wenn der Sehende unbestechlich ist. Ja, diese Fotos sind Zeugnisse der Objektiv, des Gegenfaktischen, des Faktischen, das es in ideologisch aufgeladenen Konflikten so schwer hat; sie spiegelt die Unverfälschtheit, die Sachlichkeit, nicht zuletzt die Empathie, aber keineswegs nur diese, sondern eben auch eine Realität, der nicht so fern ist, wie wir uns einreden, sondern die nach wie vor unsere Gegenwart spiegelt.
Bewegen sie uns deshalb? Oder vielleicht, weil diese Fotografen sich das abverlangten, was sich die große Mehrheit ihrer Zeitgenossen versagten: Hinschauen, wahrnehmen, festhalten, um es irgendwann einmal den Nachlebenden – und das sind wir, wir! – mitzuteilen. Diese Fotos bleiben Zeugnisse humaner Orientierung, in aller Sachlichkeit.
Vielleicht machen die Bilder auch etwas mit uns, weil die Fotografen in der Konfrontation mit dem Krieg einen Zug der Mitmenschlichkeit bewahrt hatten, der sie zu mehr als nur zu einem registrierenden, hinnehmenden Betrachter, zu einem Mitläufer und Zuschauer, sondern zu einem Chronisten, zum „Auge ihrer Zeit“ machten.
Der Krieg ist nicht der Vater aller Dinge – aber vielleicht macht er schlagartig sichtbar, was in den Menschen steckt: unbedingter Überlebenswillen, der über die Leichen des anderen geht? Rigorose Mitmenschlichkeit, gar stellvertretend mitmenschliches Handelns? Bilder machen etwas mit uns. So wird der eine oder andere auch auf diese Frage stoßen, die jetzt noch meine ganz persönliche Reaktion ist.
In ihren Bildern bewahrten der unbekannte Fotograph, Keller und Faminsky sich den Blick für alle Möglichkeiten des Menschseins. So sehen wir den Rotarmisten Faminsky am Klavier im zerstörten Berlin, so sehen wir Menschen, die um Trinkwasser anstehen (wer dächte da nicht an die hoffnungslos überfüllten Lager der Flüchtlinge aus Syrien?), so sehen wir ukrainische Mädchen, die ihre Zukunft etwa als Zwangsarbeiterinnen noch nicht einmal ahnen, wie sehen ukrainische Bäuerinnen, die vor dem lodernden Gehört stehen, das ihre Lebensgrundlage war.
Ich danke allen, die es ermöglichten, den Bogen von Warschau 1939 über die Ukraine 1941/42 bis nach Berlin 1945 zu schließen. Dies ist der Zusammenhang, den wir nicht parzellieren dürfen!
Ich danke der Galerie im Willy-Brandt-Haus und Frau Kayser, Herrn Moss, nicht zuletzt meinem Kollegen Neumärker und natürlich Frau Deres, die sich beim Beauftragten für Kultur und Medien für das Projekt sehr stark machte. Ich danke den Kuratoren Frau Druga und Herrn Gust, die – ich darf das hier sagen – mir seit den ersten Begegnungen das Gefühl gaben, dass es gelingen kann, immer wieder Jüngere zu finden, die bereit sind, sich zu Zeugen von Zeugen zu machen, also weiterzutragen, was wichtig ist für ein zivilisiertes Zusammenlebet.
Schön, dass wir es nach der coronabedingten Verschiebung vom April auf den 11. September – welch ein Datum: Ermordung von Allende 1973, Öffnung des Eisernen Vorhangs in Ungarn 1989, die Zerstörung der Twin Towers in New York mit viertausend Toten und dem Jahrestag des ersten Mordes der NSU – nun doch geschafft haben! Danke!
Wir wissen: Seit 1945 haben wir konsequent und immer wieder das Versprechen gebrochen, das im „Nie wieder!“ lag. Wir wissen, immer noch stecken wir mittendrin, Tag für Tag, von Tagesschau zu Tagesschau.
Deshalb: Was wollten die Fotografen? Zeugnis ablegen? Gewiss!
Unseren Blick schulen und prägen? Auch.
Unsere Sinne wecken? Ich denke: ja.
Vielleicht auch warnen? Vor den Verhältnissen die Menschen zu gemutet werden? Oder auch vor uns selbst?
Ich bin sicher, ihre Fixierung einer vergangenen, unbestreitbaren, nicht relativierbaren Realität kann uns heute vielleicht – und hoffentlich – verhelfen, hinzusehen, wahrzunehmen – und nicht nur dokumentarisch festzuhalten, sondern auch moralisch zu bewegen und ethisch zu beeinflussen, weil es notwendig ist, dass wir hinsehen, wahrnehmen, uns zu empören, vielleicht: um zu handeln.
Foto © Holger Biermann